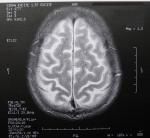Die digitale Sprache des Gehirns
Archivmeldung vom 24.05.2011
Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung am 24.05.2011 wiedergibt. Eventuelle in der Zwischenzeit veränderte Sachverhalte bleiben daher unberücksichtigt.
Freigeschaltet durch Thorsten SchmittDie universelle Sprache des Gehirns besteht aus elektrischen Impulsen, sogenannten Spikes. Jeder einzelne der Millionen Nerven im menschlichen Gehirn kann zu jedem Zeitpunkt entweder einen Spike aussenden oder ruhig bleiben. Das Gehirn repräsentiert also Informationen über die Welt ganz ähnlich wie ein Computer in einem binären Code, null oder eins, Spike oder nicht Spike. Dank neuer Entwicklungen in der Messtechnik können Neurowissenschaftler inzwischen die Aktivität von Dutzenden von Neuronen gleichzeitig messen. Doch bis heute ist nicht geklärt, welche Eigenschaften die binären Muster haben, die sich aus der Spike-Aktivität der Nervenzellen ergeben.
Dieses Dilemma hat Theoretiker unter den Neurowissenschaftlern dazu veranlasst nach statistischen Methoden zu suchen, mit denen sie die Signalmuster des Gehirns modellieren können, um besser zu verstehen, wie Sinneswahrnehmungen auf der Ebene der Nerven kodiert werden. Wichtige Anregungen dazu stammen aus der Theoretischen Physik: Physiker haben reichhaltige Erfahrungen im Studium von Systemen, in denen viele Elemente miteinander in Wechselwirkung stehen. Zum Beispiel haben sie das sogenannte Ising-Modell entwickelt, das beschreibt, wie eine große Zahl ferromagnetischer Teilchen ein kollektives Verhalten entwickelt, das letztlich den Magnetismus des Materials ausmacht.
In mehreren Studien hat sich nun gezeigt, dass dieses Ising-Modell erstaunlich präzise Beschreibungen der Aktivitäten in einer Nervenpopulation liefern kann. Dieser Erfolg eines relativ einfachen Modells hat die Hoffnung genährt, dass die Suche nach dem neuronalen Code nicht vergeblich bleiben muss. Ganz ungetrübt blieb diese Hoffnung allerdings nicht. Gerade in jüngster Zeit hat das Ising-Modell in einigen Studien die beobachtete neuronale Statistik nicht wiedergeben können. Das Modell versagte, und zwar auf charakteristische, interessante Weise.
Wann und warum liefert das stark vereinfachende Ising-Modell eine gute Beschreibung neuronaler Aktivität? Ein Team von Wissenschaftlern aus London, Berlin und Tübingen ist jetzt mit einer mathematischen Analyse einer Antwort auf diese Frage näher gekommen. Ihre Studie ist in der aktuellen Ausgabe der „Physical Review Letters“ erschienen. Die Studie entstand in Zusammenarbeit von Dr. Jakob Macke und Prof. Dr. Matthias Bethge vom Werner-Reichardt Zentrum für Integrative Neurowissenschaften (CIN) am Institut für Theoretische Physik der Universität Tübingen und dem Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik in Tübingen, sowie von Prof. Dr. Manfred Opper von der Abteilung Methoden der Künstlichen Intelligenz im Institut für Softwaretechnik und Theoretische Informatik der Technischen Universität Berlin.
Der entscheidende Punkt ihres Denkansatzes ist die Annahme, dass es gemeinsame Eingangssignale gibt, die bei allen Neuronen ankommen, die der experimentierende Wissenschaftler aber womöglich nicht direkt beobachtet. Die Annahme ist plausibel, denn zum Beispiel die Neuronen des visuellen Systems bekommen in nennenswertem Umfang Signale von anderen Neuronen, die alle auf ähnliche Weise stimuliert werden.
Der Erstautor der Studie, Dr. Jakob Macke, der nach Abschluss seiner Promotion an der Universität Tübingen an die „Gatsby Computational Neuroscience Unit“ des University College London gewechselt ist, erläutert: „Obwohl unser Modell recht einfach ist, konnten wir damit eine Reihe empirischer Beobachtungen erklären, von denen einige bisher als widersprüchlich gegolten haben. Es stimmt in gleicher Weise wie das Ising-Modell mit Messungen neuronaler Aktivitäten überein. Aber es sagt auch überraschend gut voraus, wann das Ising-Modell versagen wird und auf welche Weise es versagen wird.“ Die Einfachheit des Modells erlaubte es zu untersuchen, welche Eigenschaften es entwickelt, wenn man es auf große Nervennetzwerke anwendet. „Wir konnten quantitative Vorhersagen über das Verhalten sehr großer Nervenpopulationen machen – solcher Populationen, die sich mit den heute verfügbaren experimentellen Techniken nicht erfassen lassen, von denen wir aber glauben, dass sie sehr relevant für Rechenvorgänge im Gehirn sind“, sagt Macke.
Die Studie, so fassen die Forscher zusammen, stellt einen sehr einfachen Mechanismus vor, nämlich den der gemeinsamen Eingangssignale für alle Neuronen, liefert damit aber möglicherweise eine ganz schlichte Erklärung für eine Reihe scheinbar widersprüchlicher Beobachtungen. Damit liefert das vorgestellte Modell zudem ein schönes Beispiel dafür, wie klassische Modelle im Zusammenhang mit einem neuen wissenschaftlichen Problem wieder nützlich werden können.
Quelle: Universität Tübingen